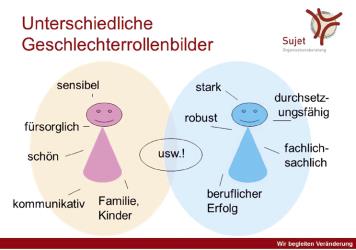
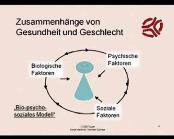
Kompakt Spezial 1/2013
19
m i c h a e l g ü m b e l
2 Andrea Fried, Ralf Wetzel, Christoph Baitsch: Wenn
zwei das Gleiche tun… vdf Hochschulverlag 2000.
3 Michael Gümbel, Sonja Nielbock: Die Last der
Stereotype. Edition der Hans-Böckler-Stiftung 2012.
„Frauenberufe“ werden häufg als weni-
ger anspruchsvoll angesehen, was sich u.
a. in der häufg ungünstigeren tarifichen
Eingruppierung niederschlägt.DieAnfor-
derungen in diesen Berufen werden oft
als „ideal für Frauen“ angesehen. Es wird
behauptet, Frauen würden „von Natur
aus“ Fähigkeiten mitbringen, die für den
Beruf erforderlich sind, wie z. B. Freund-
lichkeit, Empathie oder Fingerfertigkeit.
Die Grenzen zwischen der Erwerbsarbeit
und dem Privatleben werden in diesen
Berufen häufg weniger klar gesehen. So
besteht immer noch verbreitet dasVorur-
teil,Erzieherinnenwürden doch eigentlich
nichts anderes tun als Mütter, nur eben
mit mehr Kindern.
Nicht zuletzt zeigt sich der geringere Stel-
lenwert der „Frauenberufe“ auch in der
verspätetenEntdeckungdurchdieArbeits-
wissenschaft.Während typische Arbeits-
tätigkeiten von Männern bereits seit lan-
ger Zeit arbeitswissenschaftlich erforscht
werden, begann die Auseinandersetzung
mit den typischen „Frauentätigkeiten“
erst viel später und erlebte einen ersten
Höhepunkt gegen Ende der 1990er Jahre
mit der Erforschung derArbeit inCallcen-
tern. So lange jedoch die Wahrnehmung
der Belastungen undAnforderungen, die
mit der Tätigkeit in der Kita verbunden
sind, so stark von geschlechterstereotypen
Zuschreibungen geprägt sind, stellt sich
die Frage:Warum sollte sich ein Mann so
eineArbeit antun? Um das Ziel „MEHR
Männer in Kitas“ zu erreichen, braucht es
also auch einen neuen, vertieftenBlick auf
dieArbeitsbedingungen, eineAufwertung
der Tätigkeiten,Maßnahmen und Mittel,
umdie Bedingungen für die Beschäftigten
zu verbessern.
Wahrnehmung von Arbeitsbelastungen
Doch wie prägenGeschlechterstereotype
die Wahrnehmung und welche Bedeu-
tung hat das für die Wahrnehmung von
Arbeitsbelastungen? Zur ersten Frage
haben Schweizer Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler sehr genau
beschrieben, wie unsere Wahrnehmung
unbewusst bestimmte Dinge ausblendet,
wie wir unsereWahrnehmung unbewusst
sortieren und einordnen und wie wir das
Wahrgenommene meist ebenfalls unbe-
wusst bewerten.
2
Bei jedem Schritt spielen unsere – in der
Regel ebenfalls unbewussten – Vorstel-
lungen davon,was „männlich“ und „weib-
lich“ ist, eine entscheidende Rolle: Ohne
es recht zu wissen, sind wir alle nicht frei
davon, bestimmte Dinge bei Frauen für
„normal“ zu halten und „richtig“ zu fn-
den,diewir beiMännern befremdlich oder
zumindest „unnormal“ fnden. Das fängt
beiÄußerlichkeiten (z.B.einemRockoder
lackierten Fingernägeln) an und bezieht
sich ebenso auf Eigenschaften und Ver-
haltensweisen.
Besonders problematisch ist nun nach
Erkenntnis der Schweizer Wissenschaft-
lerinnen undWissenschaftler, dass eigent-
lich niemand zugibt, dieseRollenzuschrei-
bungen an Männer und Frauen in sich zu
tragen. Organisationen beharren darauf,
dass Beurteilungen von Personen und
Tätigkeiten objektiv zu erfolgen haben
– da ist für die Auseinandersetzung mit
Stereotypen kein Platz. Solange diese
Geschlechterbilder aber nicht refektiert
werden können und dürfen, so lange kann
eine Veränderung hier nur schwer gelin-
gen.Und ebenso lange werden vermeint-
lich wissenschaftliche Erkenntnisse über
Unterschiede zwischendenGeschlechtern,
die die verborgenen Stereotype bestätigen,
immer wieder Konjunktur haben. Es ist
eben leichter, immer wieder zu behaupten,
dass Frauen nicht einparken können und
Männer nicht zuhören können, als sich
damit auseinanderzusetzen, dass man als
Mann vielleicht doch nicht so gut einpar-
ken kann, oder dass man es als Frau nur
deshalb immer wieder verpatzt, weil man
es immer wieder gesagt bekommen hat.
Geschlechterstereotype und
wahrgenommene Belastung
Welche Bedeutung diese Stereotype bei
der Wahrnehmung von Belastungen und
Ressourcen (also dem, was Spaß macht,
Kraft gibt und unterstützt in derArbeits-
tätigkeit) spielen,wurde in einemProjekt
erforscht, das die Hans-Böckler-Stiftung
und die Gewerkschaft ver.di gefördert
haben.
3