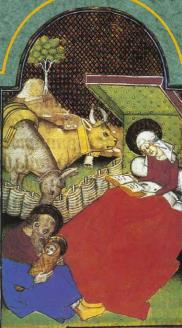
Kompakt Spezial 1/2013
37
D r . T i m R o h r m a n n
Eltern sind Modell für das Miteinander
der Geschlechter (vgl. Brandes,Andrä &
Roeseler, 2012; Datler, Gstach & Stein-
hardt, 2002; Lamb, 2004).
Lassen sich derartige Ergebnisse aus der
Väter- und Familienforschung aber auf
Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen
übertragen? Hier klafft eine Forschungs-
lücke.Untersuchungen zuUnterschieden
zwischen männlichen und weiblichen
Fachkräften in der Betreuungsarbeit mit
Kindern unter drei Jahren gibt es weltweit
überhaupt nicht.Hinweise gibt es lediglich
darauf, dass das Geschlecht der
Kinder
eine Rolle für die Erzieherinnen-Kind-
Bindung spielt. Mehrere Studien zeigen,
dass Mädchen bessere Bindungen an die
Bezugspersonen in der Kita entwickeln
als Jungen (Ahnert, Pinquart & Lamb,
2006). Vermutet wird, dass geschlechts-
stereotypeOrientierungen dermeist weib-
lichen Erzieherinnen dazu führen, dass
sie den Erwartungen von Mädchen mehr
entsprechen, was diesen wiederum den
Aufbau einer sicherenBindungsbeziehung
erleichtert.Ob Jungen bessere Bindungen
anmännliche Bezugspersonen entwickeln
würden, ist nicht bekannt, da es entspre-
chendeUntersuchungen bislang nicht gibt.
Ist die Betreuung von Kleinstkindern
Frauensache?
Den geschilderten gesellschaftlichenVer-
änderungen zumTrotz ist dieAnsicht, dass
Kinder unter drei Jahren „besser bei Frau-
en aufgehoben sind“, nach wie vor weit
verbreitet. Auch im Fachtagungsforum
wurde kontrovers über diese Aussage
diskutiert. Dabei stellte sich heraus, dass
sich diese Einstellung nicht zuletzt deswe-
gen so hartnäckig hält, weil es nur selten
Gelegenheiten gibt, andere Erfahrungen
zumachen.Besteht dagegen dieMöglich-
keit, einenmännlichen Erzieher imAlltag
zu erleben, so erweisen sich Vorbehalte
oft bald als gegenstandslos.
EineumfangreicheErhebung inÖsterreich
ergab, dass nur eine kleineMinderheit der
befragten Kinderbetreuer der Meinung
war, dass Kinder besser bei Frauen aufge-
hoben seien (Aigner &Rohrmann, 2012).
Die große Mehrheit steht Männern auch
in der Arbeit mit Kleinstkindern positiv
gegenüber. Bemerkenswert ist, dass es
für die Mehrheit sowohl der männlichen
Beschäftigten als auch der männlichen
Fachschüler/Praktikanten selbstverständ-
lich war, Kinder zu wickeln oder auf die
Toilette zu begleiten, ein nicht unerhebli-
cherTeil derMädchen und Frauen – insbe-
sondere fast die Hälfte der Schülerinnen
inAusbildung zur Kindergartenpädagogin
– dies aber nicht für selbstverständlich hielt
(S. 343). Die große Mehrheit der befrag-
ten Eltern (in der Befragung überwiegend
Mütter) waren dagegen derAnsicht, dass
ein männlicher Pädagoge alle Tätigkei-
ten im Kindergarten ausüben solle, die
auch von Frauen übernommen werden,
ausdrücklich auch Pfegetätigkeiten wie
Toilettengänge (S. 319).
Dennoch ist nicht zu übersehen, dass ein
Teil der Eltern,Kolleginnen und teils auch
Kollegen, einerTätigkeit vonMännern in
der Arbeit mit unter Dreijährigen skep-
tisch gegenübersteht.Diese Unsicherhei-
tenhaben jedochnicht nurmit einemgene-
rellenMisstrauen gegenüber Männern zu
tun, sondern auch mit dem besonderen
Charakter derArbeit mit Kleinstkindern
und der „Beziehungsrolle Pfege“. Der
nahe Körperkontakt, die Intimität und
häufge „1-zu-1-Situationen“ stellen eine
besondereAnforderung an die Beziehung
zwischen Pädagogen und Kindern dar. So
sind Kuscheln und Körperlichkeit selbst-
verständlicher Bestandteil derArbeit mit
Kleinstkindern und dürfen nicht in Frage
gestellt werden,nur umeinen potenziellen
Missbrauchsverdacht zu vermeiden.
Regelungen, die die Ausübung von Pfe-
getätigkeiten durchMänner oder den kör-
perlichenKontakt zwischenMännern und
Kindern einschränken (z.B.Wickelverbot
oder Verbot für Männer, Kinder auf den
Schoß zu nehmen) stehen daher einer
Beschäftigung männlicher Fachkräfte in
der Arbeit mit 0-3-jährigen Kindern im
Weg.
Derartige Probleme sind weit geringer in
Einrichtungen, in denen es selbstverständ-
lich ist, dass dort Männer arbeiten, weil
diese dort schon lange tätig oder aber in
der EinrichtungmehrereMänner beschäf-
tigt sind.Dann steht statt des Geschlechts
die individuelle Person imVordergrund, zu
der dieElternVertrauen aufbauenkönnen;
und Vorbehalte lösen sich oft rasch auf.
Im Infans-Eingewöhnungsmodell werden
fünf Fragen formuliert, die Eltern bewe-
gen,wenn sie ihreKinder anErzieherinnen
übergeben (Laewen & Andres, 2000, S.
22 ff.):
c
Wird sie mein Kind mögen und ver-
stehen?
c
Kann ichübermeineÄngste undZwei-
fel sprechen?
c
Kann ich vonmeinemMisstrauen spre-
chen?
c
Wird sie mein Kind an sich reißen?
c
Wird sie in Konkurrenz zu mir treten?
Diese Fragen stellen sich noch einmal in
besondererWeise,wenn die pädagogische
„Maria liest, während Joseph das Baby
wiegt“. Buchmalerei aus Nordfrankreich,
abgedruckt in „Maria liest“, herausgegeben
2004 von Andrea Günther, erschienen im
Christel-Göttert-Verlag Rüsselsheim.
www.christel-goettert-verlag.de